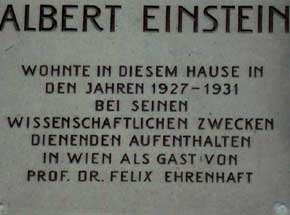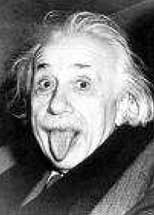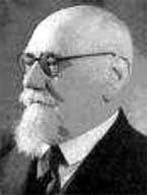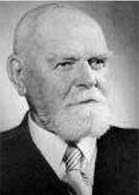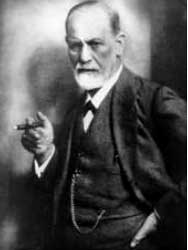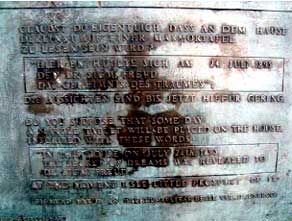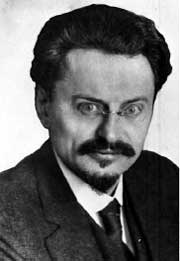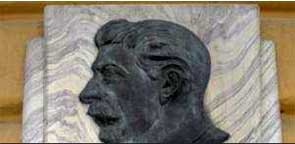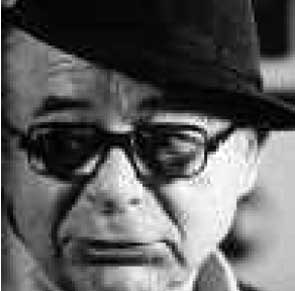|
Döblinger Spaziergang
|
erkundet und zusammengefasst von Dr. Franz Luger
|
| Grinzingerstraße 70, hier wohnte einst Albert
Einstein in den Jahren 1927 bis 1931 |
 |
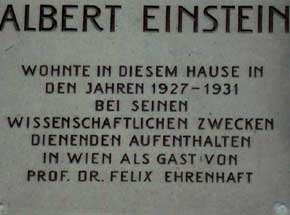 |
|
 |
Gleich in der Nähe, in der Armbrustergasse, genau gegenüber
der ehemaligen Kreisky-Villa, gibt es ein Kreisky Denkmal. Dieses stammt
vom Bildhauer Prof. Hubert Wilfan und wurde im Jahr 2003 im Beisein der
beiden Kreisky Kinder, des Altkanzlers Vranitzky, seines langjährigen
Sekretärs und späteren Finanzministers Lacina und des Bezirksvorstehers
Tiller (ÖVP) enthüllt. |
 |
| Ein weiterer historischer Ort ist die Grinzingerstraße 64;
in diesem Hause wohnten sowohl Beethoven wie auch Grillparzer. |
 |
|
Weiter oben, in der Grinzingerstraße 6, wohnte
seinerzeit Curd Jürgens mit seiner zweiten Frau Judith Holzmeister,
Tochter des berühmten Architekten. Doch Curd Jürgens war damit
überhaupt nicht zufrieden und kritisierte diese Grinzinger Wohnstätte
mit folgenden Worten: „Der alte Holzmeister zeichnete ein scheußliches
Haus. Er kann zwar Kirchen bauen aber kein Wohnhaus für lufthungrige
junge Menschen. Seine Tiroler Heimat schlägt durch: Statt Fenster Schießscharten,
statt eines großzügigen Wohnraums verschachtelte Kämmerchen
wie eine Skihütte in Kitzbühel. Das weit vorgezogene Schleppdach
soll wohl vor Lawinen schützen, aber es sieht aus wie die Mütze
eines besoffenen Grinzinger Heurigenbesuchers.“
Alsbald trennte sich Curd Jürgens von Judith Holzmeister und zog auch
aus Grinzing fort. |
 |
|
|
| Geht man die Grinzingerstraße bergaufwärts weiter,
dann gelangt man in die Himmelstraße 24. Das ist das Hörbigerhaus
Wessely, heute Theater am Himmel - empfehlenswert! |
|
|
Dann zum Haus Himmelstraße 43:
In diesem Haus wohnten vier bedeutende Persönlichkeiten, und zwar Karl
Seitz (Bundespräsident und Wiener Bürgermeister), der Mathematiker
Kurt Gödel, der Heeresminister Julius Deutsch und der Dirigent Karl
Böhm mit seinem Sohn, dem bekannten Schauspieler (Kaiser Franz Josef
in der Sissi-Trilogie) Karl Heinz Böhm. |
|
 |
|
|
| Noch weiter bergwärts gelangt man zur Adresse Himmelstraße
26, wo die beiden Bundespräsidenten Karl Renner und Theodor Körner
ihre Residenz hatten. |
|
|
|
|
| Anekdote: Karl Renner starb am Silvesterabend 1950, trotzdem
wurde am 1. Jänner 1951 seine Neujahrsansprache ausgestrahlt mit den
Worten: "Wir Österreicher lassen uns nimmermehr entmutigen. Denn
wer gleichsam von den Toten auferstanden ist, und das ist unsere Republik,
der glaubt an das Leben, vertraut auf die Zukunft und hegt vor allem Zuversicht." |
| Theodor Körner folgte Renner nach, wohnte auch hier in
der Amtsvilla und verstarb hier am 4. Jänner 1957, als er nach einem
Schlaganfall zum ersten Mal ohne fremde Hilfe die Stiegen der Präsidentenvilla
hinaufgehen wollte. Er war lebenslang ein Junggeselle und wurde als Präsident
ohne Hut und Mantel bezeichnet, da er auch bei klirrender Kälte nur
im schwarzen Anzug anzutreffen war. |
Und noch ein Stück weiter auf der Himmelstraße
gelangt man zur Bellevuewiese. Dort stand seit dem 18. Jahrhundert
unter der nunmehr aufgelassenen Adresse Himmelstraße 115 das Schloss
Bellevue, in dem eine Nervenheilanstalt untergebracht und in der Sigmund
Freud als Arzt tätig war und sich ihm am 24. Juli 1895 das Geheimnis
des Traumes enthüllte.
Nach dem ersten Weltkrieg befand sich hier noch kurze Zeit ein Kinderheim,
das Schloss wurde 1946 abgebrochen und 1963 durch das Restaurant Bellevue
nach den Plänen des Architektenehepaars Windprechtinger ersetzt. Dieses
Restaurant wurde 1982 wegen
Bauschäden liquidiert. An seiner Stelle steht jetzt ein Gedenkstein,
der über Auftrag der Tochter von Sigmund Freud von der Stadt Wien errichtet
wurde und an die medizinische
Entdeckung der Traumdeutungstheorie erinnert. |
 |
|
|
 |
Geht man bergabwärts über die Reinischgasse Richtung Kaasgrabenkirche,
die übrigens oftmals als Hintergrundkulisse für alte Filmhochzeiten
diente, dann über die Kaasgrabengasse zur Daringergasse, dann kommt
man Ecke Sieveringerstraße zum Daringerhof. Dort gab es 1916
etwas ganz Besonderes: Im Keller dieses ehrenwerten Hauses wurde die deutschsprachige
Ausgabe der PRAWDA gedruckt! Die in Wien erscheinende Prawda gab als Redaktionsadresse
an: Wien 9., Mariannengasse 17 |
|
| Ein kurzer Abstecher vom Daringerhof in die Daringergasse
12. In diesem Gemeindebau wohnte in den Jahren von 1960 bis 1976 mit
der Kinder- und Jugendbuchautorin Leomare Seidler der Kabarettist Helmut
Qualtinger. Das Gebäude trägt seit 1998, durch die Gemeinde Wien veranlasst,
ehrenhalber den Namen „Helmut-Qualtinger-Hof”. Zuletzt war Qualtinger
Mieter einer weitläufigen Wohnung in den Gebäuden des sog. "Heiligenkreuzer
Hofes" im ersten Wiener Gemeindebezirk, der dem Stift Heiligenkreuz
in Niederösterreich gehört. |
|
| Eine weitere Adresse mit politisch-historischem Background
befindet sich in der Rodlergasse 25. |
 |
|
|
In diesem Haus wohnte der Revolutionär und Gründer
der Roten Armee Leo Trotzki (geboren 1879 ermordet über Auftrag von
Stalin am 21. August 1940 in Coyoacán, Mexiko unter Anwendung eines
Eispickels) mit seiner Frau und den beiden Söhnen 1911-1914 und musste
wegen Ausbruch des 1. Weltkrieges in die Schweiz ausreisen. Für seine
Ausreisegenehmigung intervenierten maßgebliche Sozialisten, u.a. Karl
Renner. Renner kannte auch Stalin persönlich aus dieser Zeit, was sich
1945 sehr vorteilhaft auswirken sollte. Trotzki traf Stalin hier erstmals
1913. Vorher wohnte Trotzki an folgenden Adressen in Wien:
14., Hüttelbergstraße 55. Bevor Trotzki nach Döbling zog
wohnte er in Hütteldorf in der Hüttelbergstraße.. Ausgezogen
ist er, weil der Hausherr, ein jüdischer Arzt, die Miete so stark erhöht
hat … (Damals war es in Döbling offenbar noch billiger);
15., Friesgasse 40; 19., Weinberggasse 43; 19., Sieveringerstraße
19; 19., Rodlergasse 25 (1911-14). |
| Noch eine Randbemerkung zu Stalin: Er kam im Jänner 1913 auf Wunsch
Lenins nach Wien, um hier Studien zu betreiben, es entstand ein 40seitige
Abhandlung „Marxismus und die Nationalitätenfrage“. Er wohnte
bei dem Emigrantenehepaar Troyanowsky, der dann später Botschafter
in Washington wurde, |
|
in der Schönbrunner Schlossstraße Nummer 30. Im Februar kehrte
er nach Russland zurück und wurde neuerlich verhaftet. Bis zur Reise
nach Teheran 1943 war das übrigens seine letzte Auslandsreise. Heute
erinnert noch eine Gedenktafel in Hietzing an Stalins Aufenthalt in Wien. |
 |
In der Gymnasiumstraße 83, steht heute ein Studentenwohnheim.
Hier liest man an einer Tafel, dass dort früher einmal der Walzerkönig
Joseph Lanner wohnte und 1843 verstarb. |
Einige Häuser weiter liest man auf der Hausmauer des
Gymnasiums Döbling, dass hier prominente Persönlichkeiten,
darunter zwei Nobelpreisträger, unterrichtet wurden.
Aber auch heutige Prominenz, darunter Peter Alexander oder ZiB 2 Moderator
Armin Wolf besuchten dieses Gymnasium |
|
|
|
|
|
| Billy Wilder, der weltbekannte Regisseur, lebte vor Hitlers
Machtergreifung in der Billrothstraße 15 als Untermieter, wo
er für die Wiener Boulevardzeitung „Die Stunde“ als Reporter
arbeitete. Geboren wurde er am 22. Juni 1906 in Sucha Beskidzka, einem Dorf
bei Krakau. Gemeinsam mit Erich Kästner schrieb er 1931 das Drehbuch
für die Erstverfilmung von Emil und die Detektive. Er schuf Klassiker
wie "Boulevard der Dämmerung" (1950), mit Gloria Swanson
als verblendeter Ex-Diva, "Das verflixte 7. Jahr" (1955) und "Manche
mögen's heiß" (1959), beide mit Marilyn Monroe, "Zeugin
der Anklage" (1958), erneut mit Marlene Dietrich, sowie "Das Appartement"
(1960) und "Das Mädchen Irma la Douce" (1963), beide mit
Shirley MacLaine. Billy Wilder verstarb am 27. März 2002 in Los Angeles. |
| |
|
|
|

|
Döblinger Hauptstraße 94
Eduard von Bauernfeld (geb. 13.1.1802, gest. 9.8.1890)
Der Lustspieldichter mit dem Pseudonym "Rusticocampus" war gebürtiger
Wiener, den mit Niederösterreich vor allem die Aufenthalte im Schloss
Atzenbrugg im Kreis der Schubertianer verbanden. Er gilt als Meister des
Konversationsstücks mit Wiener Lokalkolorit und war Hausdichter des
Burgtheaters mit rund 1100 Aufführungen bis 1902. |
 |
Döblinger Hauptstraße 96
Bezirksmuseum Villa
Wertheimstein Wertheimstein, Leopold Ritter von, 1801 bis 1883, erwarb die
Villa in Döblinger Hauptstraße 96, jetzt Bezirksmuseum, Josephine
Wertheimstein war Dame der Wiener Gesellschaft, deren literarischer Salon
Berühmtheit erlangte.
Hier wohnte Johannes Brahms
Bertha Faber geb. Porubszky, Johannes Brahms (geboren 1833
in Hamburg, gestorben 1897 in Wien) widmete ihr zur Geburt ihres zweiten
Sohnes im Jahr 1868 das Lied op. 49 Nr. 4: Guten Abend, gute Nacht, mit
Rosen bedacht, mit Näglein besteckt, schlüpf unter die Deck: Morgen
früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt, morgen früh, wenn
Gott will, wirst du wieder geweckt. |
 |
Döblinger Hauptstraße 92
hier komponierte Beethoven
die Eroica |
|